Key Takeaways
Libido und sexuelles Verlangen werden mittlerweile synonym verwendet.
Die Ausprägung der Libido basiert auf biologischen (Hormone, Botenstoffe, Sensitivität) und psychischen Faktoren.
Die Libido schwankt in den unterschiedlichen Lebensphasen.
Im Basiswissen Libido werden die essenziellen Begriffe und Mechanismen einfach erklärt, um alles rund um Libidoverlust leicht verstehen zu können.
Was ist Libido?
Wenn wir über Sex sprechen, greifen wir häufig auf Wörter zurück, die sich für uns gut anfühlen und mit denen wir uns identifizieren können. Und das ist auch gut so. Um Probleme besser beschreiben zu können, hilft es jedoch, die Dinge differenziert benennen zu können.
Libido: Unter Libido versteht man die gesamte biologische und psychologische Energie, die auf Sexualität gerichtet ist. Häufig wird sie mit dem Sexualtrieb gleichgesetzt, also dem inneren Drang oder der Motivation für sexuelle Aktivität. Libido ist dabei weniger ein akuter Impuls als vielmehr ein konstantes Potenzial. Sie bildet die Grundlage dafür, dass wir überhaupt sexuell denken, fühlen oder handeln können.
Verlangen: Das sexuelle Verlangen ist die bewusste Erfahrung der Libido in einem bestimmten Moment. Es entsteht situativ, ausgelöst durch äußere Reize (z.B. eine attraktive Person) oder innere Faktoren (z.B. Fantasien). Wenn man die Libido als Tankfüllung eines Autos betrachtet, ist das sexuelle Verlangen das Gaspedal. Eine hohe Libido kann dazu führen, dass man oft sexuelles Verlangen verspürt; umgekehrt kann eine niedrige Libido dazu führen, dass man seltener sexuelles Verlangen erlebt.
Während die Begriffe früher stärker unterschieden wurden, werden sie mittlerweile de facto als Synonyme verwendet. Libido wird dabei oft als das subjektive Erleben von sexuellem Verlangen betrachtet. Daher unterscheiden auch wir nur dort, wo es einen Mehrwert bringt.
Lust: Sexuelle Lust beschreibt das akute Empfinden von Erregung, Freude und Befriedigung während sexueller Aktivität oder sexueller Gedanken. Sie ist das „positive Gefühl“, das im Moment der sexuellen Stimulation entsteht und das sexuelle Verhalten verstärken kann. Man könnte die Lust also mit einem guten Fahrerlebnis vergleichen.

Mechanismen des sexuellen Verlangens
Sexuelles Verlangen basiert auf einem fein abgestimmten System aus Hormonen und Botenstoffen (Neurotransmittern) im Gehirn. Wie stark die eigene Libido ausgeprägt ist, ist letztlich eine Folge der individuellen „Verkabelung“ und des Zusammenspiels dieser beiden Systeme, kombiniert mit psychischen Faktoren.
Hormone: Das grundlegende Potential
Hormone setzen das Grundpotenzial für die Libido.
- Testosteron (+): Testosteron ist das wichtigste Hormon für die Ausprägung der Libido. Das oft als „männliches Sexualhormon“ bezeichnete Testosteron kommt jedoch nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen vor. Es steigert das sexuelle Verlangen, indem es an Rezeptoren in Gehirnregionen bindet, die für Emotionen und Triebe zuständig sind. Zudem verbessert es die Durchblutung und Sensibilität der Genitalien. Männer haben in der Regel deutlich höhere Testosteronspiegel als Frauen, was zu einer tendenziell stärker ausgeprägten Libido führen kann.
- Östrogen (+): Das als „weibliches Sexualhormon“ bekannte Östrogen unterstützt das sexuelle Verlangen, vor allem bei Frauen. Es steigert die Durchblutung und Empfindlichkeit der Genitalregion und beeinflusst die Stimmung positiv. Außerdem wirkt es über Dopamin-, Serotonin- und Oxytocin-Rezeptoren und unterstützt so Nähe, Motivation und sexuelle Aktivität. Besonders während des Eisprungs, wenn der Östrogenspiegel am höchsten ist, kann daher das sexuelle Verlangen verstärkt sein.
- Prolaktin (-): Seine direkte Wirkung auf die Libido entfaltet Prolaktin hauptsächlich nach dem Orgasmus, wo der Spiegel kurzfristig ansteigt und die sexuelle Erregung dämpft. Längerfristig beeinflusst Prolaktin die Libido vor allem indirekt, indem es die Ausschüttung von Testosteron und Östrogen hemmt. Vor allem erhöhte Werte können daher mit einem reduzierten sexuellen Verlangen verbunden sein. Es gibt allerdings immer mehr Hinweise, dass auch sehr niedrige Spiegel an Prolaktin die Libido negativ beeinflussen könnten.
- Weitere wichtige Hormone mit indirektem Einfluss auf das sexuelle Verlangen sind
- Progesteron (-): Senkt die Libido, vor allem in der zweiten Zyklushälfte oder in der Schwangerschaft, indem es Dopamin und Testosteron hemmt.
- Cortisol (-): Stresshormon, das vor allem bei langfristiger Erhöhung die Libido dämpft, indem es Dopamin und Testosteron hemmt.
Neurotransmitter: Die Belohnungsschleife
Der eigentliche Antrieb für sexuelles Verlangen wird von Neurotransmittern im Gehirn gesteuert, die ein Belohnungssystem bilden.
- Dopamin (+): Dopamin ist der wichtigste Botenstoff für den Sexualtrieb. Es aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn und verstärkt Motivation und Lust. Jedes Mal, wenn wir eine Handlung ausführen, die uns Vergnügen verschafft (sei es Essen, Sport oder Sex), wird Dopamin ausgeschüttet. Dieses System motiviert uns, die Handlung zu wiederholen. Ein hoher Sexualtrieb ist daher oft mit einer höheren Aktivität in der dopaminergen Belohnungsschleife verbunden.
- Serotonin (-): Serotonin wirkt oft als Gegenspieler von Dopamin. Während Dopamin den Trieb und die Motivation fördert, kann Serotonin das Verlangen dämpfen.
- Weitere Neurotransmitter mit Einfluss auf das sexuelle Verlangen sind
- Vasopressin (+): Unterstützt sexuelle Motivation und Bindung, vor allem bei Männern, und wirkt dopaminmodulierend.
- Oxytocin (+): Fördert Nähe, Vertrauen und Intimität und verstärkt dadurch sexuelles Verlangen, insbesondere bei Frauen.
- Noradrenalin (+): Steigert Erregung, Aufmerksamkeit und Blutfluss, kann das sexuelle Interesse erhöhen.
- Acetylcholin (+): Fördert Erregung und Durchblutung im Genitalbereich, bei Männern wesentlich für die Erektion.
- Endogene Opioide (-): Nach dem Orgasmus stark aktiv, hemmen Dopamin und Oxytocin und sorgen so für die Refraktärphase mit verringertem Verlangen.
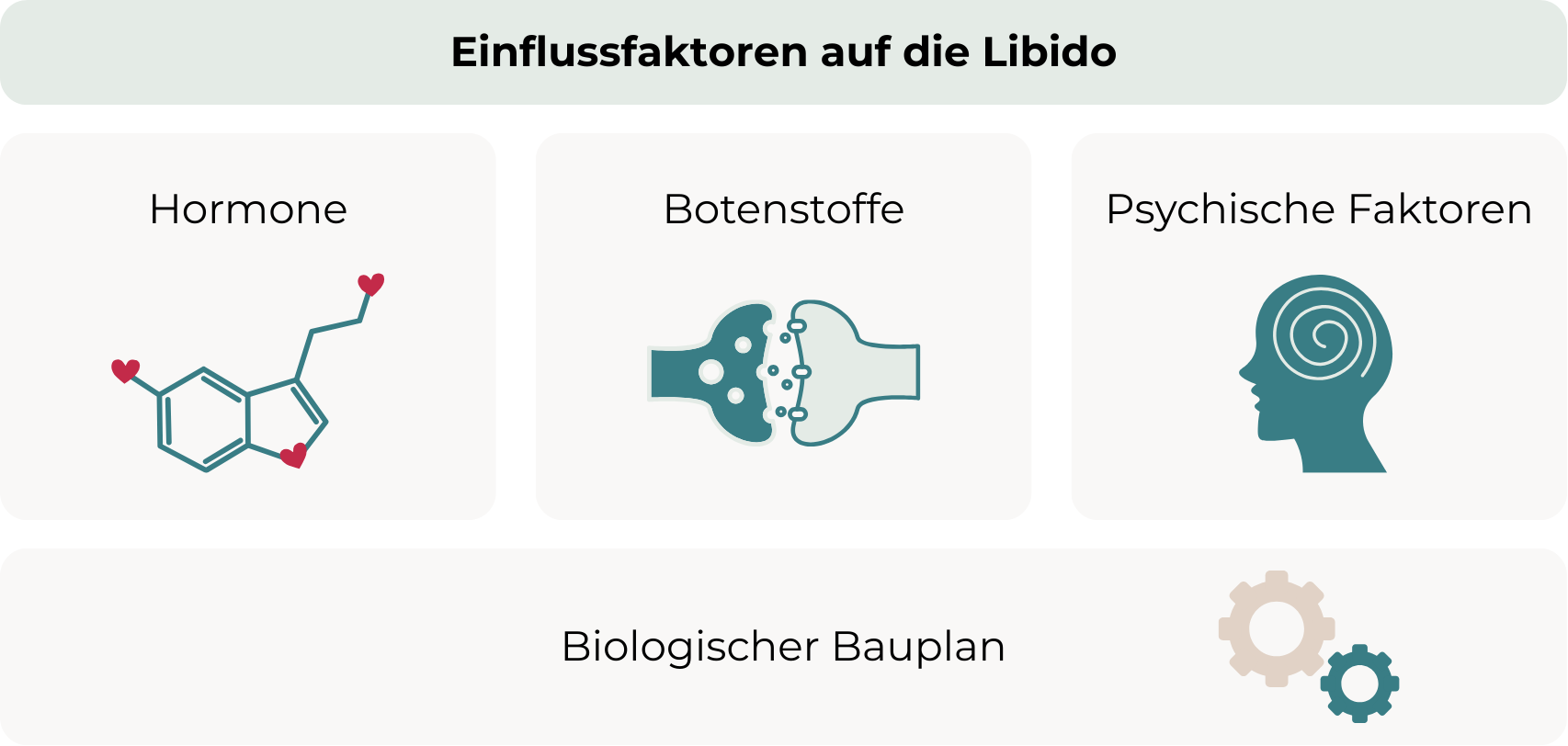
Wie alles zusammenkommt
Die individuelle Ausprägung der Libido entsteht durch die einzigartige Kombination dieser Systeme:
- Grundausstattung: Die genetische Veranlagung, also der biologische Bauplan, bestimmt, wie empfindlich die Rezeptoren im Gehirn für Testosteron sind und wie aktiv die dopaminerge Belohnungsschleife arbeitet. So können zwei Menschen mit gleichen Hormonwerten durch unterschiedlich sensible Rezeptoren eine völlig unterschiedlich stark ausgeprägte Libido haben.
- Hormoneller „Pegel“: Der aktuelle Hormonspiegel, insbesondere von Testosteron, setzt den „Pegel“ des Triebs. Auch Östrogen und andere Hormone sowie die relativen Verhältnisse zu ihnen können das sexuelle Verlangen beeinflussen.
- Neurochemisches Gleichgewicht: Das Verhältnis von Dopamin zu Serotonin und anderen Neurotransmittern entscheidet, wie motivierend und belohnend sexuelles Verlangen wahrgenommen wird.
- Modulierende Faktoren:
- Erfahrung: Positive oder negative sexuelle Erlebnisse verstärken oder dämpfen die dopaminerge Belohnungsschleife.
- Psychische Faktoren: Stimmung, Stress, Bindung, Angst, Fantasie, Selbstwahrnehmung sowie soziale und kulturelle Prägung beeinflussen das konkrete Erleben von Libido.
- Gesundheit und Lebensstil: Schlaf, Ernährung, Bewegung, Medikamente und Krankheiten modulieren die hormonellen und neurochemischen Grundlagen.
Libido im Laufe des Lebens
Die Libido ist nicht statisch, sondern verändert sich im Laufe des Lebens. Unsere sexuelle „Grundenergie“ schwankt nämlich in den unterschiedlichen Lebensphasen. In der Pubertät steigt sie oft sprunghaft an, da Sexualhormone erstmals in größerer Menge ausgeschüttet werden. Im frühen Erwachsenenalter erreicht das sexuelle Verlangen bei vielen Menschen seinen Höhepunkt. Ab dem mittleren Lebensalter nimmt die Libido tendenziell leicht ab. In den Wechseljahren (bei Frauen) und in der Andropause (bei Männern) kann sie noch einmal spürbar schwanken, bevor sie im höheren Alter zunehmend von der allgemeinen körperlichen und psychischen Gesundheit beeinflusst wird.
Das sexuelle Verlangen ist mit den Schwankungen der Libido verbunden, aber dabei viel situationsabhängiger. So spielen hier Faktoren wie Stress und Beziehungsdynamik eine bedeutende Rolle.
Quellen
Parish SJ, et al. (2021) International Society for the Study of Women’s Sexual Health Clinical Practice Guideline for the Use of Systemic Testosterone for Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33797277/
Pfaus JG. (1999) Neurobiology of sexual behavior. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10607643/
Pfaus JG. (2009) Pathways of sexual desire. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19453889/
Rastrelli G, et al. (2025) The hormonal regulation of men’s sexual desire, arousal, and penile erection: recommendations from the fifth international consultation on sexual medicine (ICSM 2024). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40519205/
Santi D, et al. (2018) Molecular basis of androgen action on human sexual desire. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28893567/

